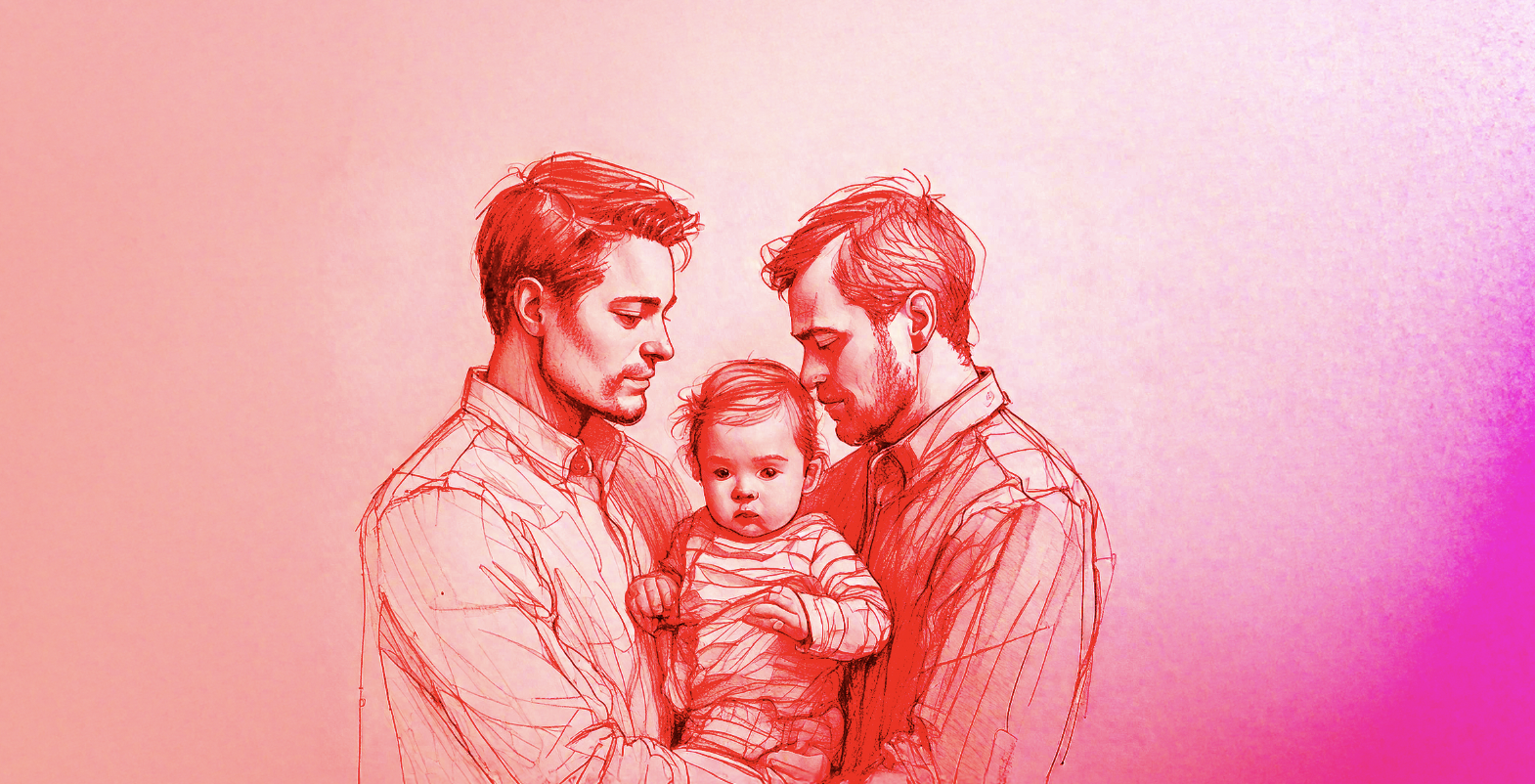
In der Schweiz können gleichgeschlechtliche Paare erst seit wenigen Jahren ein Kind adoptieren. Jonathan und Fabio gehören zu den ersten schwulen Paaren, für welche dieser Traum wahr wurde.
Fabio wird diesen Anruf im Februar 2020 nie mehr vergessen: «Barbara Hinnen von PACH war am Telefon und fragte, ob ich sitze.» Sie teilte Fabio mit, dass er und sein Partner Jonathan als Adoptiveltern für den kleinen Amaru ausgewählt wurden. Ein Moment, der das Leben der beiden für immer veränderte. Sohn Amaru war damals drei Monate alt. «Daddy» und «Papi», wie Amaru seine Väter nennt, haben ihren Sohn grade in den Kindergarten gebracht. Jetzt sitzen sie im Café und erzählen ihre aussergewöhnliche Geschichte. Sie sind das erste schwule Paar, das bisher ein in der Deutschschweiz zur Adoption freigegebenes Kind adoptierte.
Kinderwunsch
Als sich die beiden 2016 kennen lernten, merkten sie bald, dass beide einen Kinderwunsch hegten. Doch wie sollten sie als schwules Paar eine Familie gründen? Sie prüften verschiedene Möglichkeiten. Sie hatten von Paaren gehört, die über Leihmutterschaft Eltern wurden. Jonathan und Fabio war es besonders wichtig, dass ihr Kind eines Tages wissen darf, wer seine Eltern sind. «Auch darum kam für uns eine Leihmutterschaft nicht in Frage, und wir prüften die Variante Adoption.» Mit der damaligen Gesetzgebung war die Adoptionfür gleichgeschlechtliche Paare noch nicht möglich. Das änderte sich erst mit dem Ja zu «Ehe für alle» 2022. Aber es bestand die Möglichkeit, als Einzelperson in den Vermittlungspool aufgenommen zu werden, und der Partner oder die Partnerin konnte später das Kind als Stiefelternteil adoptieren.
Kaum Chancen auf Adoption
Sie besuchten im Sommer 2018 eine Adoptions-Informationsveranstaltung von PACH und verstanden schnell, wie klein ihre Chancen waren: «Es gibt in der Schweiz nur sehr wenige Kinder, die zur Adoption freigegeben werden, und als Zwei-Väter- Familie entsprachen wir so gar nicht dem traditionellen Familienbild», sagt Jonathan. Sie entschieden sich, es trotzdem zu versuchen. Fabio reichte bei der Kantonalen Zentralbehörde Adoption seine Unterlagen ein. «Wir gingen das Ganze sehr entspannt an», erinnert sich Fabio. Wenn es klappen sollte, wäre das ein grosses Glück. Doch sie wussten, dass sie auch ohne Kind ein erfülltes Leben führen konnten.
Sozialabklärung
Es folgte die sogenannte Sozialabklärung. «Es wird geprüft, ob sich die gesuchstellenden Personen als Adoptiveltern eigenen», erklärt Barbara Hinnen. Es werden jeweils zwei bis drei Gespräche geführt mit den Interessierten – eines davon bei ihnen zu Hause. Fabio und Jonathan machten von Anfang an transparent, dass sie das Kind gemeinsam grossziehen würden, auch wenn Fabio sich als Einzelperson anmeldete. «Ein schwuler alleinerziehender Vater hätte gar keine Chance gehabt», ist Fabio überzeugt. «Dass Jonathan ausgebildeter Kleinkindbetreuer ist, trug sicher auch dazu bei, dass man uns gegenüber so offen war», sagt er augenzwinkernd. «Bei Hetero-Paaren geht man wohl davon aus, dass Frauen solche Kompetenzen auf natürliche Weise mitbringen, einfach, weil sie Frauen sind», vermutet Fabio. Ein Klischee, dem Väter noch oft begegneten.
Aufnahme
Die beiden schafften die Hürde: Fabio wurde Mitte 2019 offiziell in den Vermittlungspool geeigneter Adoptiveltern aufgenommen. Für acht bis zwölf Kinder jährlich werden in der Deutschschweiz Adoptiveltern gesucht. Im Pool befinden sich hingegen durchschnittlich 50 bis 60 Paare und Einzelpersonen, die ein Kind annehmen möchten. «Man sagte uns, es könne Jahre dauern, bis wir für ein Kind als Eltern ausgesucht werden – wenn überhaupt», erinnert sich Jonathan.
Plötzlich Väter
Als dann nur acht Monate später, im Februar 2020, der Anruf von PACH kam, war Jonathan im ersten Moment völlig überfordert: «Es ist, wie wenn du erfährst, dass du im achten Monat schwanger bist. Auf einen Schlag.» Kurz darauf durften sie ihren Sohn kennen lernen. Er lebte bei einer Übergangspflegefamilie, die seit vielen Jahren regelmässig Kinder bei sich aufnimmt, bis die rechtliche Situation geklärt und ein Zuhause gefunden wurde. Der drei Monate alte Amaru schlief friedlich in seinem Bettchen. Die beiden Väter wussten, dass er in wenigen Wochen bei ihnen leben würde. «Es fühlte sich ein wenig an, als würden wir der Familie das Kind wegnehmen», erinnern sich Jonathan und Fabio.
Sorgfältiger Übergang
Barbara Hinnen von PACH und die Vormundin von Amaru nahmen auch am ersten Treffen teil. Es sei ein ganz spezieller Moment, wenn sich das Kind und die künftigen Adoptiveltern zum ersten Mal treffen. Die Freude der Adoptiveltern sei immer riesig, und natürlich bestehe auch oft eine gewisse Verunsicherung, erzählt Barbara Hinnen. Auf Seiten der Pflegefamilie sei neben der Freude für das Kind oftmals auch Trauer spürbar. «Denn es ist nicht einfach, ein Kind loszulassen und in andere Hände zu übergeben. Darum ist es für alle Beteiligten wichtig, die Übergänge sorgfältig zu begleiten und für das Kind sanft zu gestalten», betont die PACH-Mitarbeiterin.
Eine Familie entsteht
Es folgten innerhalb der nächsten Wochen viele weitere Treffen, auch bei den frisch gebackenen Vätern zuhause. Amaru blieb jedes Mal ein bisschen länger bei seinen Papis. «Die Übergangspflegeeltern waren sehr liebenswert und hilfsbereit», sagt Jonathan dankbar. Er hatte als Kleinkindbetreuer schon viel Erfahrung mit Babys, für Fabio war alles neu: «Ich wusste, was im Lehrbuch stand. Aber ich lernte schnell, auf mein Bauchgefühl zu hören und gut zu spüren, was Amaru braucht», sagt er selbstbewusst. «Rasch vertrauten wir darauf, dass er uns Zeichen gibt und wir diese verstehen. Von Anfang an war da eine starke Verbindung.» Während der Pandemie hatten die drei viel Zeit, als Familie zusammenzuwachsen. Freunde und Familie lernten ihren Sohn mit der Zeit kennen. Die beiden strahlen, wenn sie von ihrem Kind erzählen. Von seinem fröhlichen Naturell und wie er auf alle Menschen offen zugehe. «Wir drei passen einfach so gut zusammen», schwärmt Fabio. «Er spricht mit allen und kommt gut an. Das fällt im positiven Sinn auf uns zurück, obwohl davon natürlich viel sein Wesen ist und nur ein Teil die Erziehung.»
Rollenbilder brechen auf
Die beiden teilen sich die Betreuung hälftig auf. Jonathan lacht, als er sagt: «Bei uns ist immer Papatag.» Er spricht damit die weitverbreitete Rollenverteilung mit der Mutter als Hauptbetreuerin an. «Mein Chef wunderte sich, dass ich nach Hause ging, als mein Sohn krank war, weil dies sonst meist die Mütter tun.» Er habe dann aber gemerkt, dass er in Stereotypen denke. «Insofern regen wir Menschen manchmal betreffend Rollenvorstellungen zum Nachdenken an, ohne etwas dafür zu tun», freut sich Fabio.
Weniger unter Druck als Mütter
Amaru schmuse gerne mit seinen Vätern, erzählt Jonathan. «Uns fällt auf, dass es oft eher die Mütter sind, die in der Öffentlichkeit knuddeln.» Überhaupt suche er sich mehr männlich gelesene Leute zum Spielen aus. Er sei weniger auf Frauen fixiert. Ausser bei den Grosseltern. «Die Grosis sind ganz wichtige Bezugspersonen», so Jonathan. Die beiden fühlten sich nie bedroht in ihrer Stellung als Väter, erzählt Fabio: «Nie hatten wir das Gefühl, wir müssten einer gesellschaftlichen Mutterrolle kompensatorisch gerecht werden.» Im Gegenteil; er habe als Vater oft weniger Druck verspürt als Mütter. Was besonders nerve, sei die Frage, wer von ihnen beiden mehr die Mutter und wer mehr der Vater sei: «Wir sind beide beides, unser Sohn holt sich von uns beiden, was er braucht», betont Jonathan. Es sei für sie immer wieder erstaunlich, welch dominante Rolle der Mutter zugesprochen werde. Auch bei der Herkunftssuche gehe es primär darum herauszufinden, wer die Mutter ist, gibt Fabio zu bedenken: «Ist es nicht genau so wichtig zu wissen, wer der Vater ist?»
«Daddy und Papi»
Und wie reagierte das Umfeld? «Unser Freundeskreis freute sich sehr und unsere Eltern konnten ihr Glück kaum fassen.» Sie hätten nicht damit gerechnet, Grosseltern zu werden, und seien sehr engagiert. Diskriminierung als schwule Väter haben die beiden nie erlebt. «Zürich ist sehr offen», meint Jonathan. «Wenn wir mit unserem Sohn unterwegs sind, könnten wir auch zwei Kollegen sein, wir fallen nicht auf.» Viele würden sich sicher wundern, wo das Mami sei. Aber die meisten seien sehr zurückhaltend mit Fragen, auch in der Kita oder jetzt im Kindergarten. «Wenn ihm jemand sagt, du hast zwei Papis, korrigiert unser Sohn und sagt: Nein, ich habe einen Daddy und einen Papi», erzählt Jonathan schmunzelnd. Amaru kenne nichts anderes, für ihn sei alles ganz selbstverständlich. Sie hätten in ihrem Umfeld auch Leute mit anderen Familienformen, zum Beispiel ein Vater und zwei Mamis. «Amaru mag das Bilderbuch ‹Lou erkundet die Nachbarschaft›, welches ganz verschiedene Formen von Familien zeigt», erzählt Jonathan.
Amaru kennt seine Geschichte
Kürzlich hörte Fabio, wie ein anderes Kind Amaru fragte, wo sein Mami sei. «Er sagte, wir wüssten es nicht, und spielte weiter.» Die beiden Väter erzählten ihrem Sohn schon von seinem Bauchmami, als er noch ein Baby war. Dieses frühe Thematisieren, die sogenannten Wickeltischgespräche, seien ihnen in den Vorbereitungskursen ans Herz gelegt worden, erzählt Fabio. Für ein Kind ist es zentral, seine Entwicklungsgeschichte zu kennen. «Egal, ob mehr oder weniger bekannt ist über die Eltern», betont Barbara Hinnen, die Eltern dabei unterstützt, die richtige Sprache zu finden. Fabio und Jonathan erzählten Amaru dessen Geschichte oft. «Inzwischen reagieren wir eher, wenn er selbst Fragen dazu stellt.» Als Amaru dreieinhalb war, fragte er zum ersten Mal von sich aus nach seiner Mutter. Das kam aus dem Nichts. «Wir sagten ihm, dass wir es nicht wissen», erinnert sich Jonathan. «Dann überlegten wir gemeinsam, ob sie vielleicht als Perlentaucherin oder Astronautin unterwegs sei.» Es ist spürbar, wie sorgfältig die beiden Väter mit dieser Verantwortung umgehen. «Wir sagen ihm, es habe sein Bauchmami ganz viel Kraft gekostet, ihn uns anzuvertrauen, und dass sie dies aus Liebe getan hat, weil sie ihm nicht alles hätte geben können, was er brauche», schildert Fabio diese «Bauchmami-Gespräche».
Offiziell Adoptiveltern
Die Adoption kann gemäss gesetzlichen Vorgaben erst nach einem gemeinsamen Jahr des Zusammenlebens (Pflegejahr) beantragt werden. Nachdem Fabio offiziell als Adoptivvater eingetragen war, konnte Jonathan seinerseits das Adoptionsgesuch stellen. Es dauert gut zwei Jahre, bis die beiden offiziell die rechtlichen Väter waren. Es sei eine Erleichterung gewesen, als die Adoption formal abgeschlossen war, erinnern sie sich. Der Umstand, dass Amaru nicht ihr biologische Kind ist, spielt keine Rolle: «Wir sind eine Familie – wir seine Eltern und er unser Kind», sagt Jonathan glücklich.
Ein grosses Glück
Das Unmögliche ist für Fabio und Jonathan möglich geworden. «Heute können wir es kaum fassen, dass es geklappt hat», sagen die beiden dankbar. Und welche Voraussetzungen begünstigten dieses Glück? Sie hätten wohl in der Kombination überzeugt, meint Fabio. «Wir ergänzen uns sehr gut.» Allein hätte er kein Kind adoptieren können, ist er überzeugt. «Es kam uns auch zugute, dass wir keine Erwartungshaltung an ein Kind hatten und offene Personen sind.»
Ist die Schweiz bereit für Adoptivväter? Das hange vermutlich auch etwas von der Region ab, sagen die beiden. Vorurteile gebe es weniger als früher und sicher nicht mehr viele Leute teilten die Vorstellung, der Sohn schwuler Eltern werde schwul. «Manchmal machen wir Witze, dass Amaru doch ein richtiger Macker werden solle, damit die letzten Zweifel verschwinden», ergänzen die beiden Väter lachend.
Mehr lesen zum Adoptionprozess
* Alle Namen wurden geändert. Für PACH steht das Kindeswohl immer zuoberst. Die beiden stolzen Väter haben keine Scheu vor Öffentlichkeit. Aber ihr Sohn ist noch klein und soll eines Tages selbst bestimmen, ob und wie er seine Geschichte erzählen möchte.
